Ich habe bei einer Dualboot-Installation von Windows 10 und Linux-Mint / LUBUNTU / XUBUNTU große Probleme mit GRUB bekommen. Bisher hat das nie Probleme bereitet aber bei diesem alten PC klappt es nicht. Die Hinweise von CHATGPT waren sicher richtig, haben mich aber auch nicht wirklich weiter gebracht, weil die KI doch recht viel geschwafelt hat und die Vorschläge nicht wirklich zielführend waren. Deshalb habe ich mich entschlossen ein wenig hinter die Kulissen von GRUB zu schauen um es selbst zu verstehen und entsprechend einrichten zu können.
Wie funktionier GRUB?
Diese Frage habe ich CHATGPT gestellt. Die Antwort:
Grub (GRUB = GRand Unified Bootloader) ist ein Bootloader, also das Programm, das gestartet wird, sobald ein PC eingeschaltet wird, um ein Betriebssystem zu laden. Ich erkläre dir Schritt für Schritt, wie er funktioniert und warum er so nützlich ist:
1. Boot-Reihenfolge im PC
Wenn ein PC eingeschaltet wird, passiert folgendes:
- BIOS/UEFI startet: Prüft Hardware und sucht ein Boot-Medium.
- Bootloader wird geladen: BIOS/UEFI lädt den Bootloader (z. B. GRUB) von der ersten Boot-Partition (MBR oder EFI-Systempartition).
2. GRUB selbst
GRUB ist ein flexibler Bootloader, der mehrere Betriebssysteme starten kann. Er besteht typischerweise aus mehreren Stufen:
a) Stage 1 (kleinster Teil, MBR oder EFI)
- Liegt am Anfang der Festplatte oder EFI-Partition.
- Kann nur sehr wenig Speicher nutzen.
- Lädt Stage 2 oder direkt die Konfiguration.
b) Stage 2 (größerer Teil)
- Hat Zugriff auf Dateienysteme (ext4, NTFS, FAT32…).
- Kann die GRUB-Konfigurationsdatei lesen:
grub.cfg.
- Zeigt das Bootmenü an.
- Ermöglicht Auswahl zwischen mehreren Betriebssystemen, Kernel-Optionen usw.
3. Bootmenü
- GRUB zeigt eine Liste von Betriebssystemen oder Kernel-Versionen an.
- Der Benutzer kann auswählen oder GRUB startet automatisch nach einer Zeitüberschreitung.
- Ein Kernel wird ausgewählt → GRUB lädt Kernel + initrd (initial RAM disk) in den Speicher.
4. Kernel starten
- GRUB übergibt die Kontrolle an den Kernel.
- Kernel startet die Hardware und das Betriebssystem vollständig.
5. Besondere Features von GRUB
- Unterstützt mehrere Betriebssysteme (Linux, Windows, BSD…).
- Kann Dateisysteme direkt lesen → man muss keine festen Sektoradressen kennen.
- Hat eine Kommandozeile, falls etwas schiefgeht (
grub rescue>).
- Kann auch Netzwerk-Boot (PXE) oder verschlüsselte Partitionen starten.
Kurz gesagt:
GRUB ist das Bindeglied zwischen BIOS/UEFI und deinem Betriebssystem. Er liest die Boot-Konfiguration, zeigt ein Menü an, lädt den Kernel und übergibt dann die Kontrolle an das Betriebssystem.
Wenn du willst, kann ich auch eine grafische Übersicht zeigen, wie GRUB von BIOS bis Kernel arbeitet – das macht es sehr anschaulich. Willst du, dass ich das mache?
Gut… noch nicht sehr erhellend aber ich lass dass erst mal so stehen.
Die grafische Übersicht habe ich hier nicht übernommen, da sie, wie meistens bei CHATGPT, eher verwirrt als hilft.
Wenn GRUB kaputt ist
Die Antwort von CHATGPT:
Wenn GRUB kaputt ist (z. B. nach einem Update, einer falschen Konfiguration oder weil ein anderes OS den Bootloader überschrieben hat), gibt es mehrere Möglichkeiten, das Problem zu beheben. Hier eine Übersicht, was du tun kannst:
1. Mit einem Live-System starten
- Lade dir ein Linux-Live-ISO (z. B. Ubuntu, Debian, Linux Mint) herunter.
- Starte den Rechner von USB oder DVD.
- Öffne ein Terminal.
2. Root-Partition einhängen
Angenommen, deine Linux-Root liegt auf /dev/sda2:
sudo mount /dev/sda2 /mnt
Falls du eine separate Boot-Partition hast, auch die mounten:
sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot
UEFI-Systeme: EFI-Partition mounten (meist /dev/sda1 mit FAT32):
sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi
3. System-Umgebung vorbereiten
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
Dann ins System wechseln:
sudo chroot /mnt
4. GRUB neu installieren
Für BIOS/Legacy-Systeme:
grub-install /dev/sda
Für UEFI-Systeme:
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=GRUB
Danach Konfiguration neu erzeugen:
update-grub
oder (je nach Distro):
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
5. Neustarten
exit
sudo umount -R /mnt
reboot
6. Alternative: Boot-Repair
Es gibt das Tool Boot-Repair, das viele Schritte automatisch erledigt. Unter Ubuntu kannst du es so installieren (im Live-System):
sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair
sudo apt update
sudo apt install -y boot-repair
boot-repair
Damit kannst du oft mit einem Klick GRUB reparieren.
👉 Wichtig: Sag mir, ob du BIOS (Legacy) oder UEFI nutzt und welche Linux-Distribution du hast – dann kann ich dir eine maßgeschneiderte Schritt-für-Schritt-Anleitung geben.
Möchtest du, dass ich dir gleich ein Minimal-„Rettungsrezept“ für UEFI + Ubuntu/Debian schreibe?
Wie bekomme ich heraus ob mein Rechner im BIOS- oder UEFI-Modus bootet?
Sehr gute Frage 👍 – das ist entscheidend, weil GRUB unterschiedlich installiert wird, je nachdem ob dein System im Legacy-BIOS-Modus oder im UEFI-Modus läuft.
Hier ein paar einfache Methoden:
1. Unter Linux (wenn du das System noch starten kannst)
Prüfen ob /sys/firmware/efi existiert:
ls /sys/firmware/efi
- Wenn der Ordner existiert und Dateien enthält → UEFI-Boot.
- Wenn er nicht existiert → Legacy-BIOS-Boot.
2. Im Live-System (von USB gestartet)
Auch hier kannst du wie oben prüfen:
ls /sys/firmware/efi
Wenn der Ordner leer oder nicht vorhanden ist → dann bist du im Legacy-BIOS-Modus gebootet.
3. Unter Windows (falls Dual-Boot)
Win + R → msinfo32 eingeben.- Dort steht bei BIOS-Modus:
- „UEFI“ → UEFI-Boot
- „Legacy“ → BIOS-Boot
4. Boot-Struktur auf der Festplatte ansehen
- Wenn deine Festplatte eine EFI-Systempartition (FAT32, ca. 100–500 MB, gemountet unter
/boot/efi) hat, ist das fast sicher ein UEFI-System.
- Wenn es stattdessen nur eine MBR-Partitionstabelle ohne EFI-Partition gibt → Legacy-BIOS.
👉 Empfehlung: Wenn du gerade im Live-Linux bist, probiere direkt mal:
ls /sys/firmware/efi
Willst du, dass ich dir ein Kochrezept für die Reparatur von GRUB schreibe, je nachdem ob das Ergebnis UEFI oder BIOS ist?
Mein System ist kein UEFI sondern ein BIOS-System. Dafür hat mir CHATGPT die folgende Anleitung gegeben:
Danke für die Ausgabe 👍 – das macht die Sache klarer.
Analyse deiner Partitionstabelle
- /dev/sda1 (100 MB NTFS) → Das ist keine EFI-Systempartition, sondern eine klassische Windows-„System-reserviert“-Partition.
- /dev/sda2 (≈160 GB NTFS) → Windows 10 selbst.
- /dev/sda3 (500 MB NTFS) → wahrscheinlich Windows Recovery.
- /dev/sda4 (erweitert) + /dev/sda5 (63 GB Linux, Typ 83) → hier liegt dein Lubuntu.
👉 Es gibt keine EFI-Systempartition (FAT32), stattdessen nur eine MBR-Partitionstabelle mit NTFS und ext4.
Schlussfolgerung
- Dein Windows läuft im Legacy-BIOS-Modus (MBR).
- Dein Lubuntu wurde auch im BIOS-Modus installiert.
- GRUB gehört also in den MBR der Festplatte (/dev/sda), nicht in eine EFI-Partition.
Reparaturschritte für GRUB (aus Live-Lubuntu)
- Root-Partition mounten:
sudo mount /dev/sda5 /mnt
- Wichtige Systemverzeichnisse einbinden:
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
- In dein installiertes System wechseln:
sudo chroot /mnt
- GRUB in den MBR von
/dev/sda schreiben:
grub-install /dev/sda
update-grub
- Rausgehen und aushängen:
exit
sudo umount -R /mnt
- Neustarten:
reboot
Danach sollte beim Starten wieder der GRUB-Bootloader erscheinen, mit Auswahl zwischen Windows 10 und Lubuntu.
👉 Willst du, dass ich dir dafür ein komplettes Copy&Paste-Skript schreibe, das du im Live-Lubuntu nur durchlaufen lassen musst?
Das hat im Prinzip funktioniert. Allerdings wird kein Bootmenue angezeigt, sondern gleich Lubuntu gestartet. Da dort die Grafikkarte nicht richtig eingerichtet wird bleibt der Bildschirm nach der Anzeige des Logos schwarz.
Das Verhalten von GRUB einstellen.
Dazu lieferte CHATGPT folgende Anleitung:
Verstanden 👍 – wenn dein installiertes Lubuntu nicht richtig bis zum Desktop bootet (wegen Grafiktreiber), kannst du die GRUB-Konfiguration auch aus dem Live-System anpassen.
Dazu im Prinzip dieselbe Vorgehensweise wie bei der GRUB-Reparatur:
1. Lubuntu-Partition mounten
sudo mount /dev/sda5 /mnt
2. Systemverzeichnisse einbinden
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
3. Chroot ins installierte System
sudo chroot /mnt
4. GRUB-Konfiguration bearbeiten
nano /etc/default/grub
Ändere/füge ein (falls Zeilen fehlen, einfach hinzufügen):
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
⚠️ Wichtig: GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false ist nötig, damit Windows 10 automatisch erkannt und ins Menü aufgenommen wird.
5. GRUB aktualisieren
update-grub
Du solltest dann etwas sehen wie:
Found Windows Boot Manager on /dev/sda1
6. Beenden und aushängen
exit
sudo umount -R /mnt
reboot
Damit solltest du beim nächsten Booten aus dem MBR-GRUB-Menü Windows 10 auswählen können – selbst wenn Lubuntu wegen Grafikproblemen schwarz bleibt.
👉 Soll ich dir gleich eine komplette Minimalversion von /etc/default/grub hier hinschreiben, die du 1:1 ins Live-System kopieren kannst?
Nun funktioniert der Bootvorgang so wie er soll.
Wie findet GRUB die Betriebssysteme?
Das scheint automatisch zu gehen. Ich werde das vielleicht später mal klären.
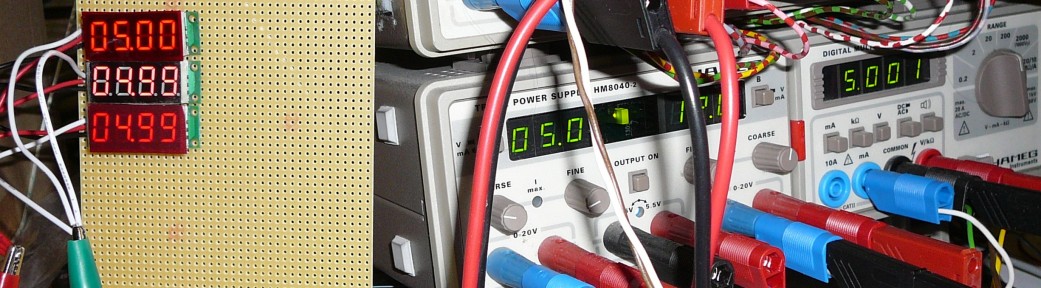
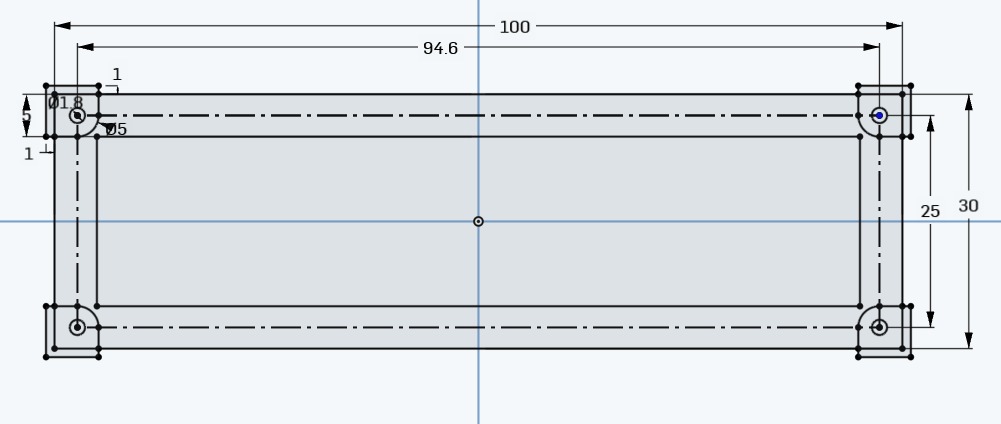
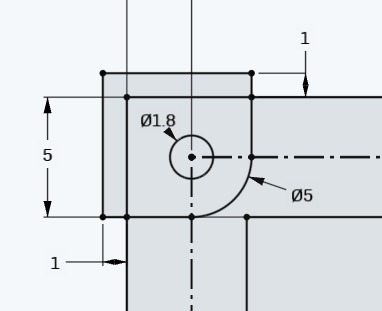
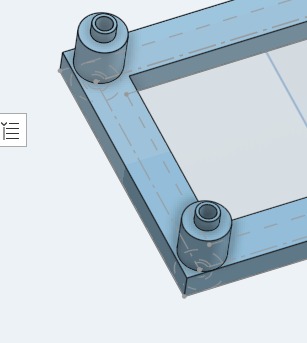
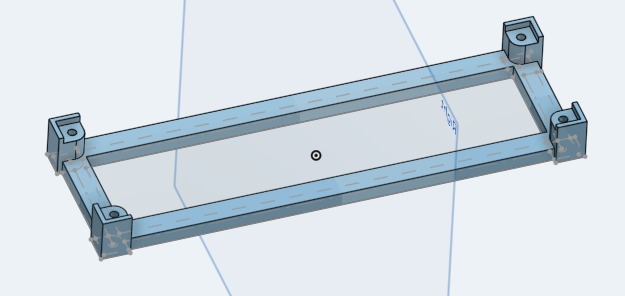
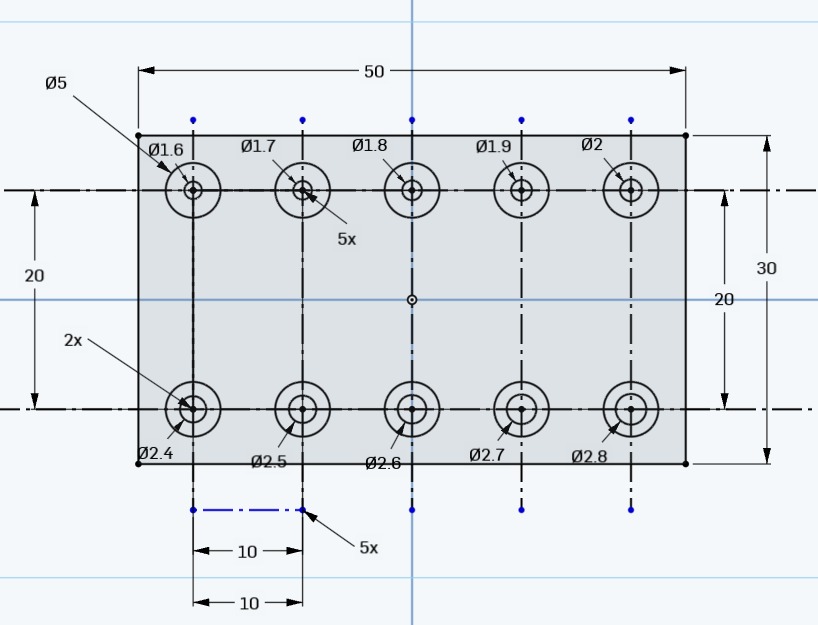
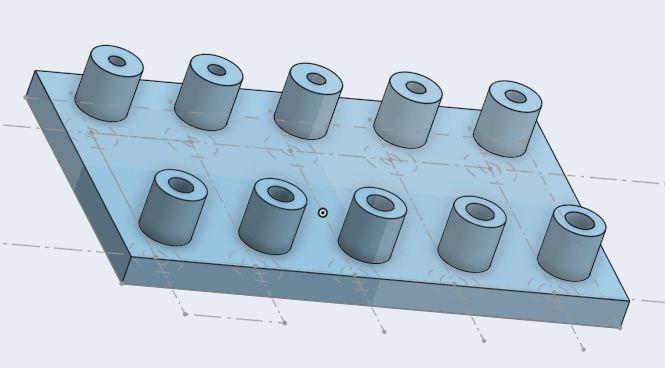


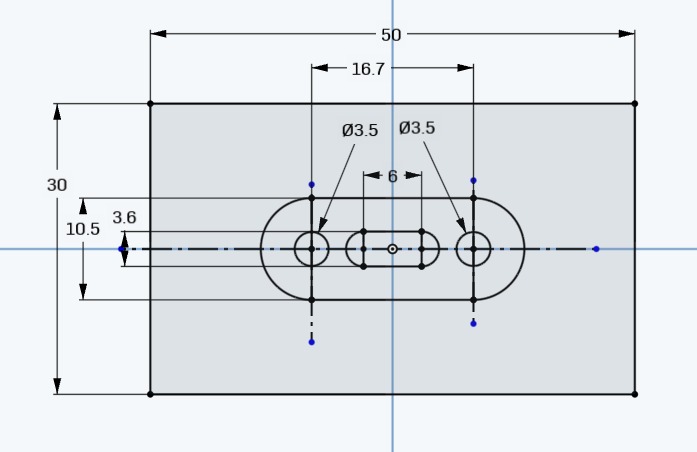
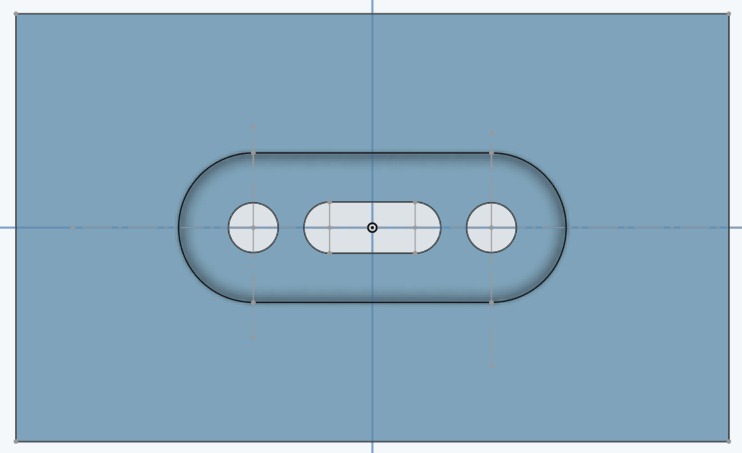
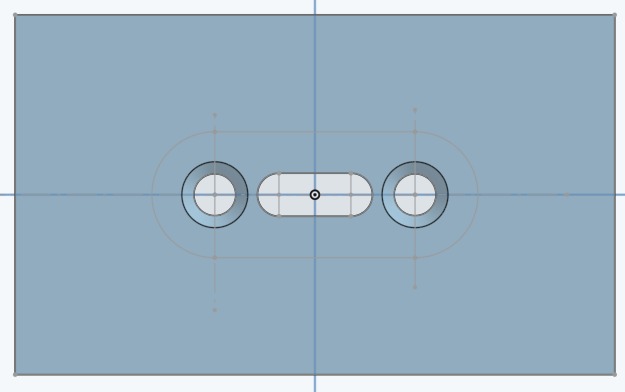
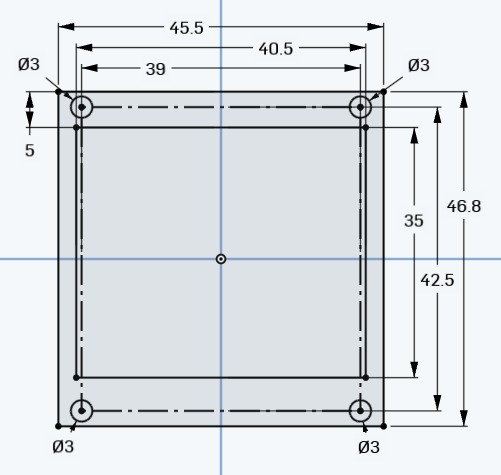
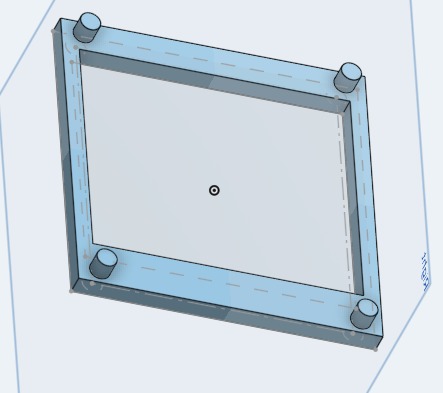
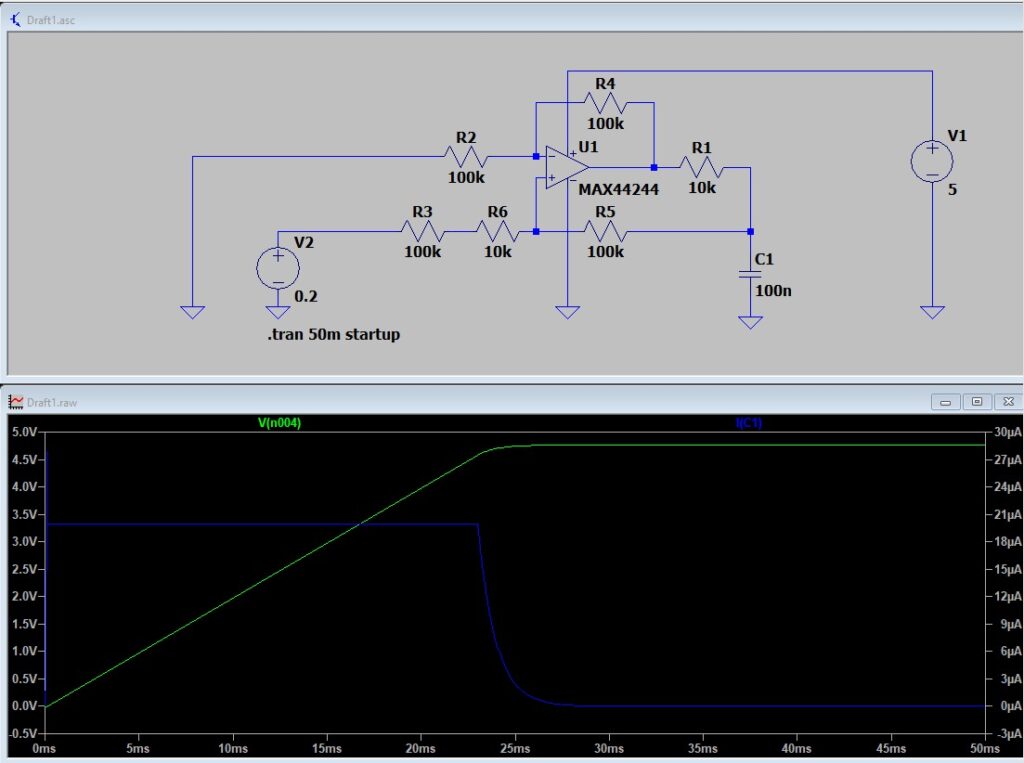
Neueste Kommentare